27. November 2025 I Kategorie: FamilienrechtAmtsG Köln rügt KI-erfundene Fundstellen – Sammlung von Rechtsprechungen
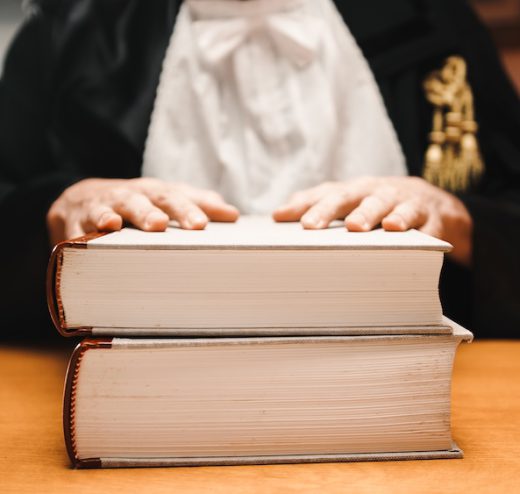
Die Juristerei lebt von präzisen Zitaten, verlässlichen Quellen und echter Rechtsprechung. Wer eine Gesetzesnorm auslegt oder ein Urteil argumentativ stützen will, greift auf bewährte Literatur und Gerichtsentscheidungen zurück – idealerweise in gedruckten Kommentaren oder anerkannten Datenbanken. Der Fall, den das Amtsgericht Köln jüngst entschieden hat, zeigt jedoch: Wenn Quellen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) generiert werden, drohen erhebliche Fallstricke. Plötzlich stehen vermeintliche Urteile und Kommentare im Raum – die aber in Wahrheit gar nicht existieren.
Der konkrete Fall: KI-Halluzinationen vor Gericht
In einem Verfahren vor dem Amtsgericht Köln reichte ein Rechtsanwalt einen Schriftsatz ein, der offenbar mit Hilfe von KI erstellt worden war – inklusive zahlreicher Fundstellenangaben. Bei genauer Prüfung zeigte sich jedoch: Viele der zitierten Entscheidungen und Kommentare existierten nicht. Einzelne Angaben verwiesen auf falsche Seiten oder frei erfundene Urteile. Das Gericht rügte dieses Vorgehen deutlich und stellte klar, dass Anwälte verpflichtet sind, Quellen eigenständig zu prüfen, bevor sie diese in Schriftsätzen verwenden.
Warum das problematisch ist
Solche sogenannten KI-Halluzinationen gefährden nicht nur die Glaubwürdigkeit eines Schriftsatzes, sondern können das gesamte Verfahren beeinträchtigen. Das Gericht ist gezwungen, sämtliche Angaben besonders kritisch zu hinterfragen, was zu Verzögerungen führen kann. Zudem kann der Eindruck entstehen, dass ein Verfahren nicht mit der gebotenen Sorgfalt betrieben wird. Im schlimmsten Fall drohen sogar berufsrechtliche Konsequenzen für den verantwortlichen Anwalt.
Was dieser Fall für die Sammlung von Rechtsprechung bedeutet
Der Vorfall zeigt eindrücklich, wie wichtig eine verlässliche Sammlung von Urteilen und Fachliteratur ist. Gedruckte Bücher im Regal, strukturierte Archive und geprüfte Datenbanken stehen für Ordnung, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit. Während KI zwar bei der Recherche unterstützen kann, ersetzt sie nicht die Kontrolle durch den Menschen. Nur echte Urteilstexte und anerkannte Fachzeitschriften bieten die notwendige Sicherheit, auf die Gerichte und Mandanten vertrauen dürfen.
Empfohlene Vorgehensweise für die juristische Praxis
Sie sollten jede Fundstelle sorgfältig überprüfen, bevor sie in Schriftsätze aufgenommen wird. Dazu gehört die Kontrolle von Aktenzeichen, Erscheinungsjahr und Seitenangaben in der Originalquelle. Automatisch generierte Literaturlisten dürfen niemals ungeprüft übernommen werden. Eine saubere Dokumentation schützt vor Fehlern und bewahrt die eigene Reputation. Sorgfalt ist und bleibt das Fundament der juristischen Arbeit.
Risiken beim unkritischen KI-Einsatz
KI kann wertvolle Hilfe leisten – etwa zur Strukturierung eines Textes oder als Ideengeber. Doch sie darf nicht zur alleinigen Quelle juristischer Argumentation werden. Je komplexer ein Rechtsgebiet ist, desto größer ist das Risiko, dass Inhalte unzutreffend oder unvollständig sind. Wer sich blind auf Technik verlässt, begibt sich rechtlich auf unsicheres Terrain.
Fazit: Verlässlichkeit statt Automatik
Die Sammlung echter Rechtsprechung bleibt unverzichtbar. Der Fall des Amtsgerichts Köln macht deutlich, dass nicht jede technische Neuerung unreflektiert übernommen werden sollte. Juristische Qualität entsteht nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch Genauigkeit. Gedruckte Literatur und geprüfte Datenbanken sind deshalb mehr denn je Grundlage seriöser Arbeit.
Wenn Sie rechtliche Unterstützung im Familienrecht benötigen und auf verlässliche Beratung setzen möchten, wenden Sie sich an Stefan Haschka. Als Fachanwalt für Familienrecht in Augsburg steht er Ihnen als erfahrener Rechtsanwalt und Experte im Familienrecht zur Seite. So stellen Sie sicher, dass Sie auf fundierte Rechtsprechung setzen – nicht auf erfundene Quellen.


